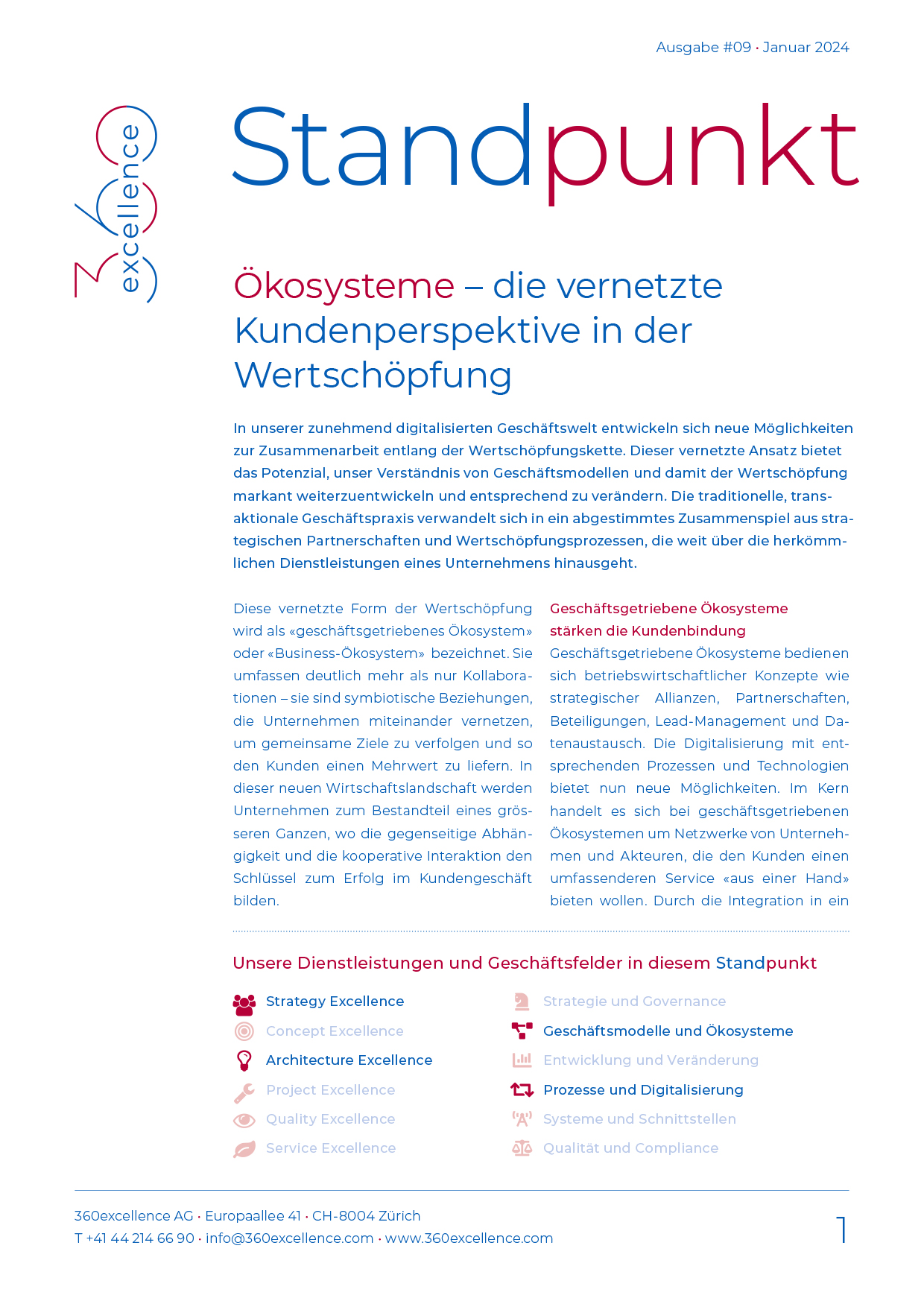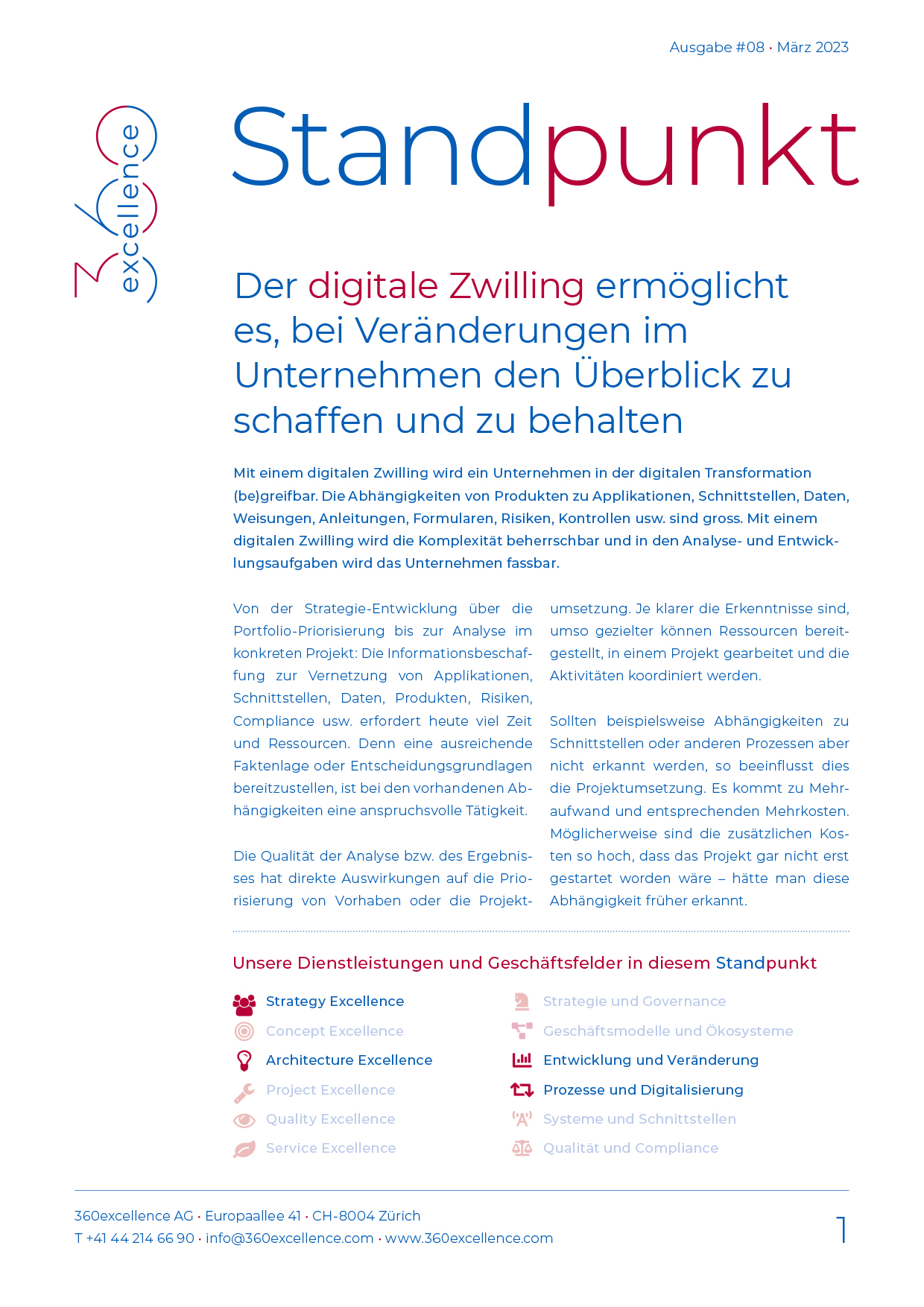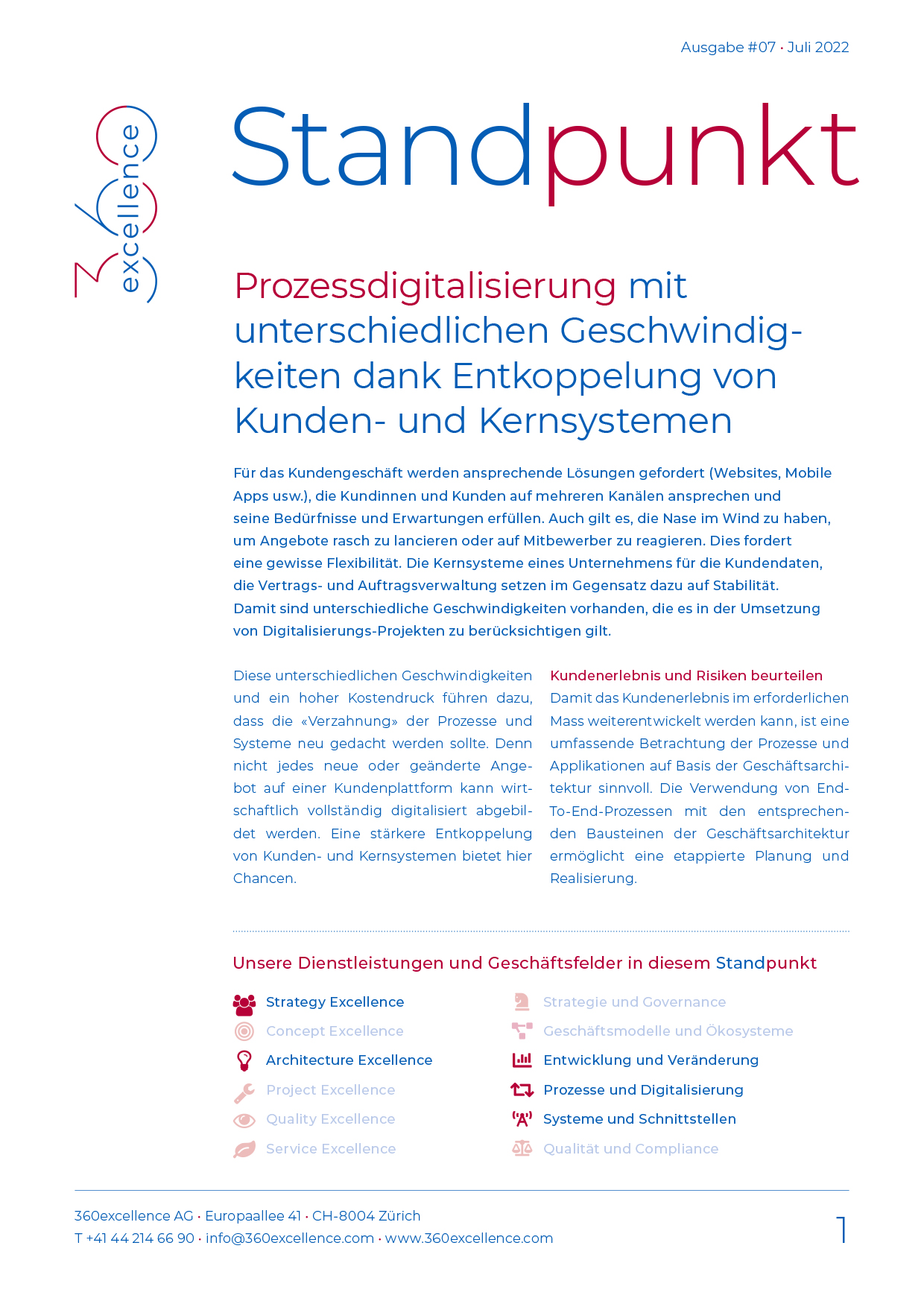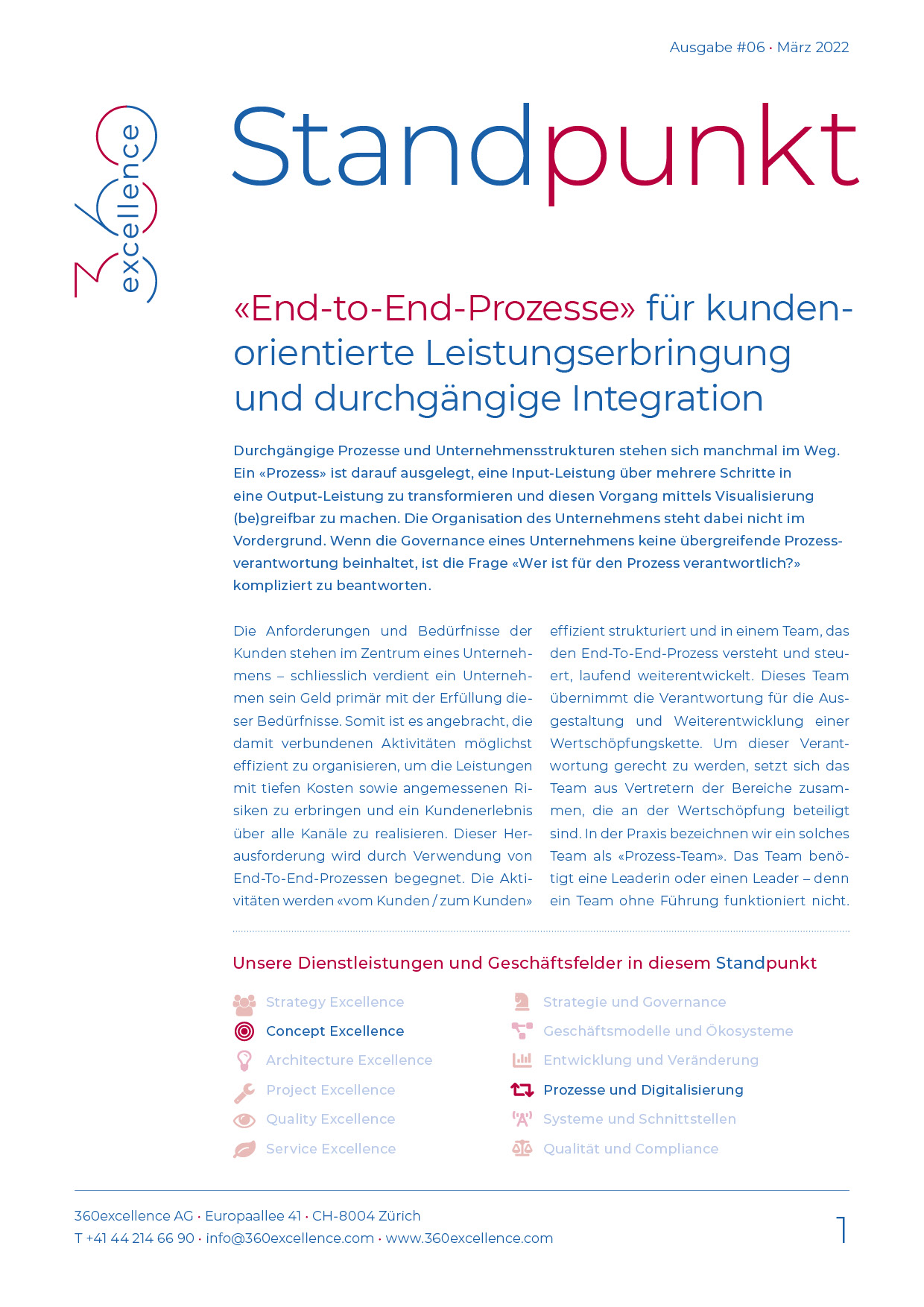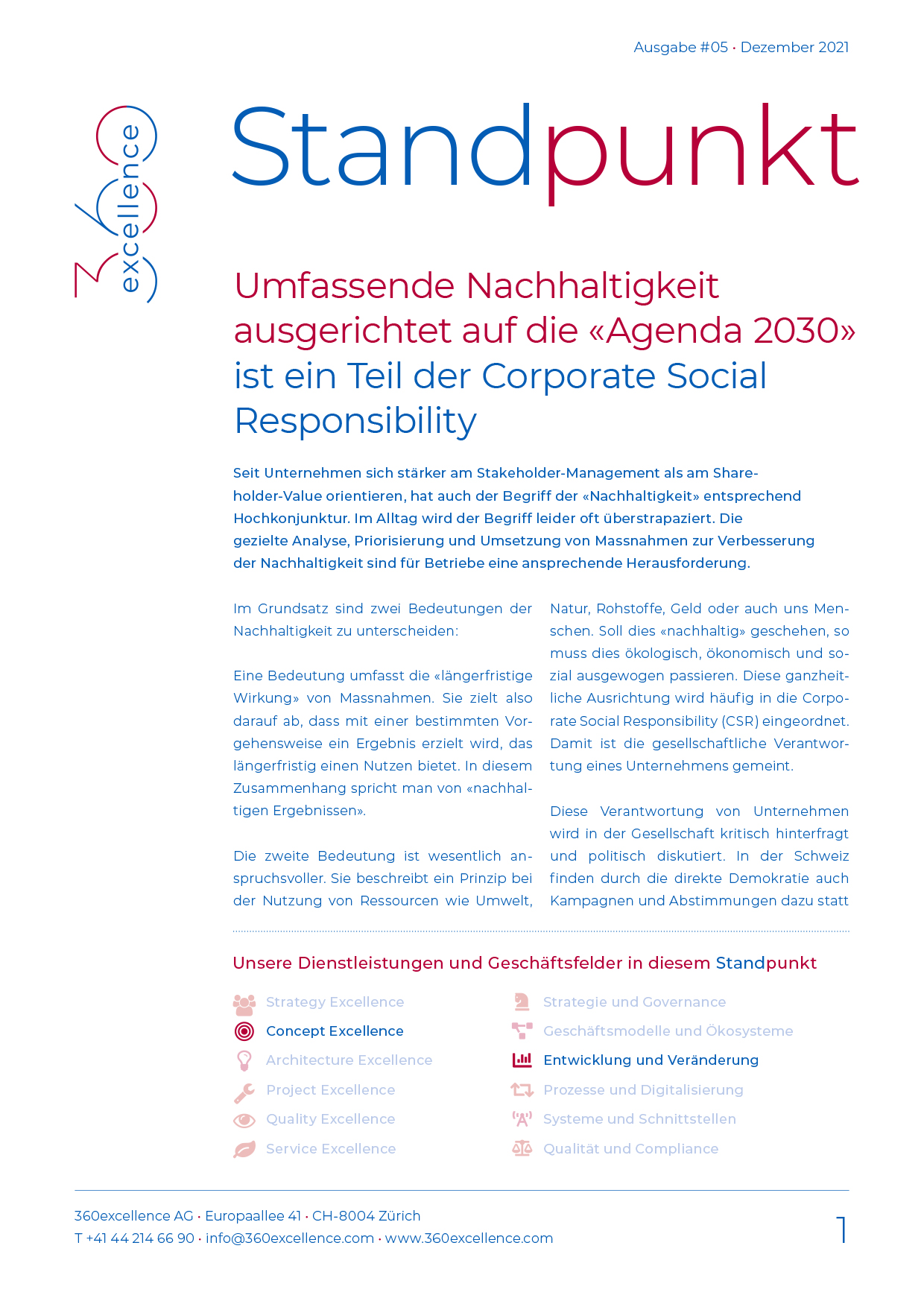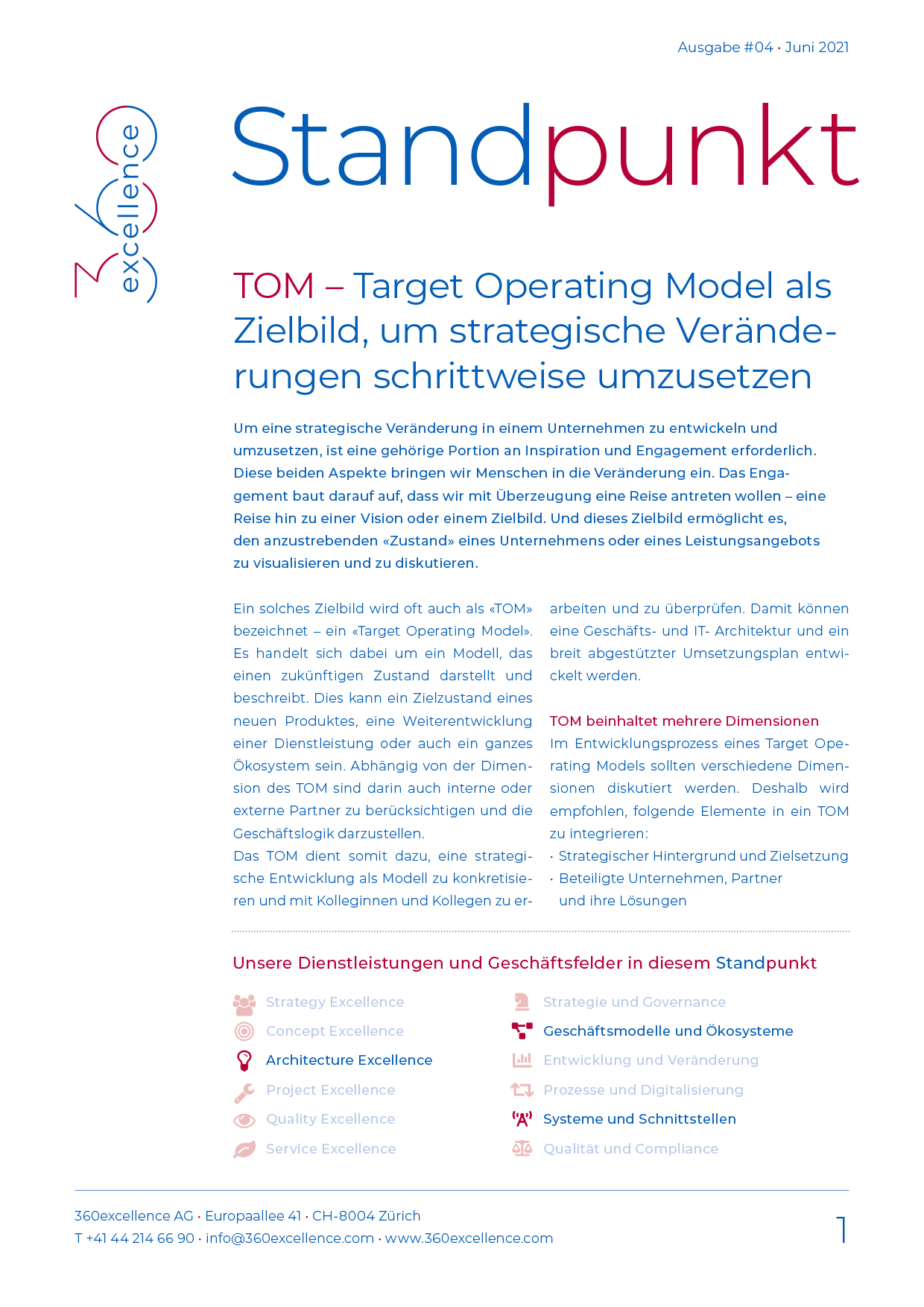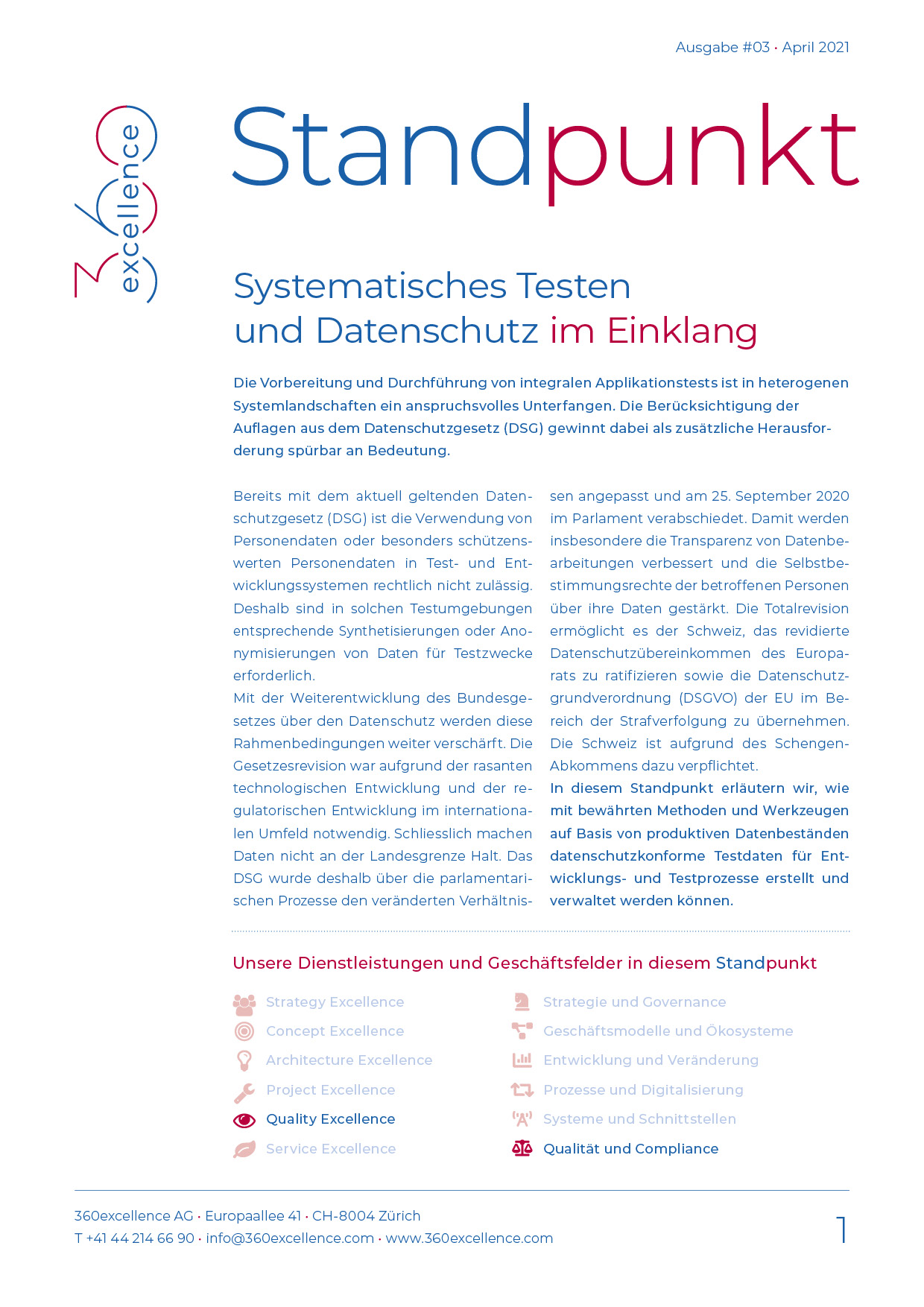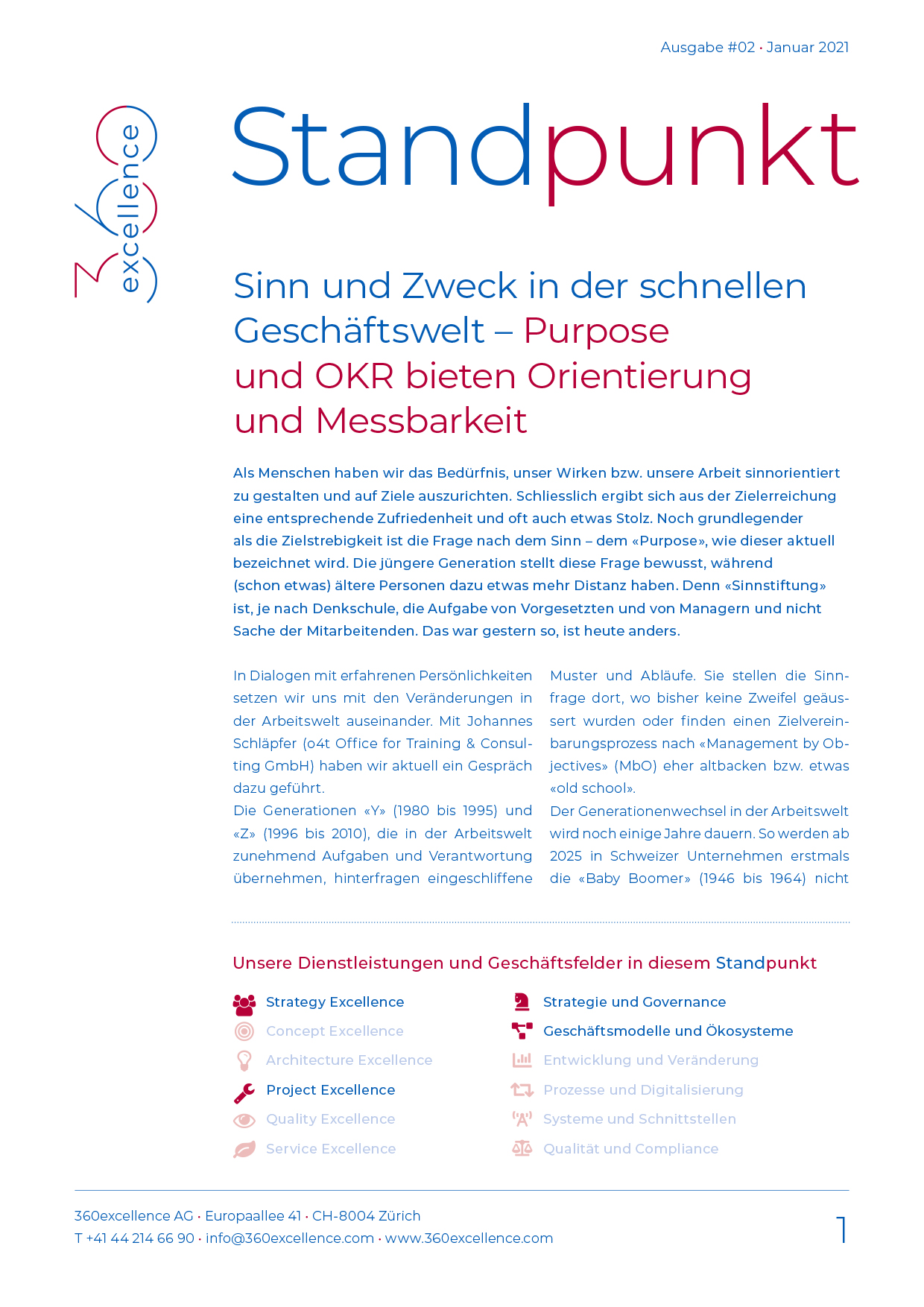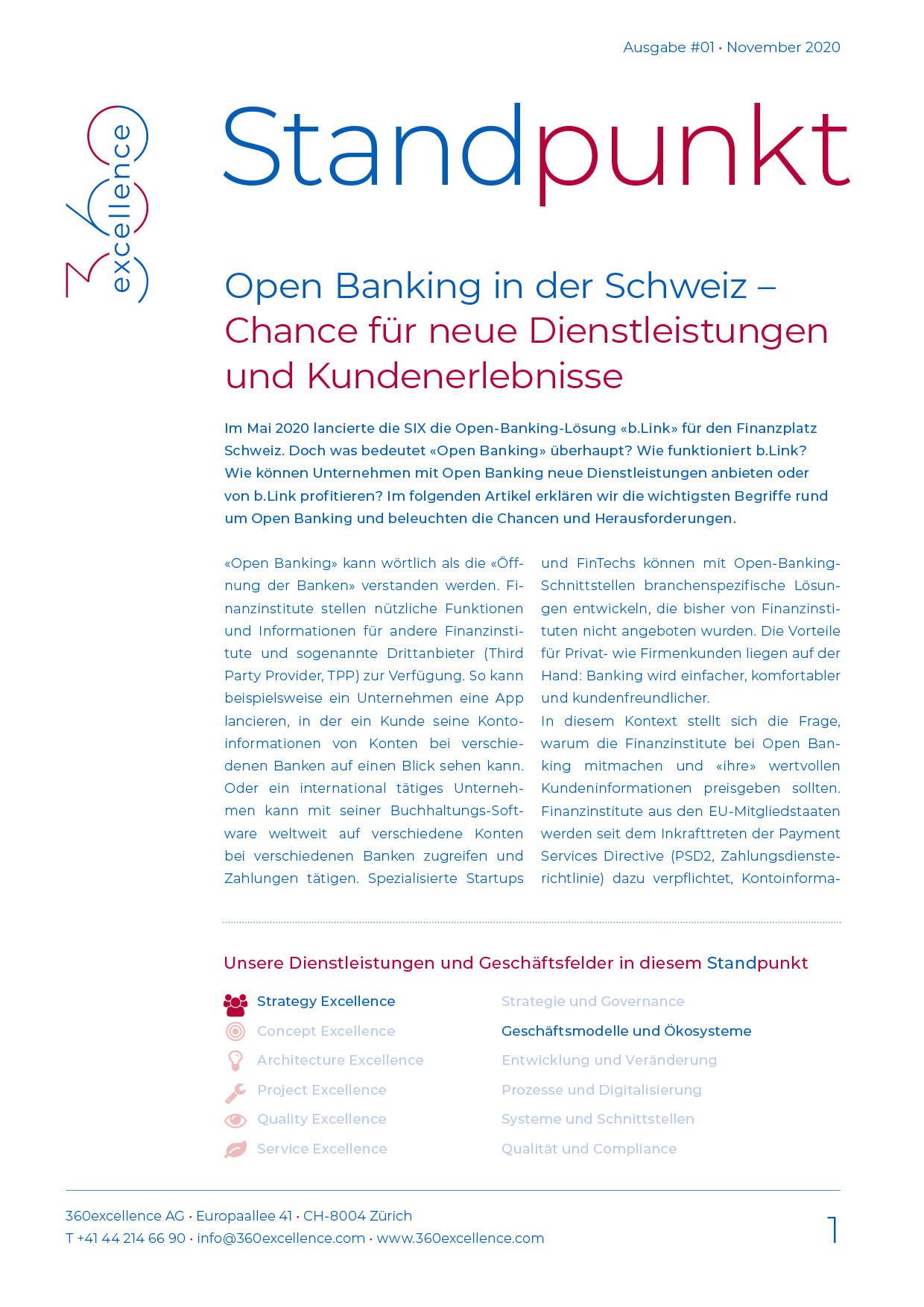Standpunkt
Ausgabe #09 • Januar 2024
In unserer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt entwickeln sich neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette. Dieser vernetzte Ansatz bietet das Potenzial, unser Verständnis von Geschäftsmodellen und damit der Wertschöpfung markant weiterzuentwickeln und entsprechend zu verändern. Die traditionelle, transaktionale Geschäftspraxis verwandelt sich in ein abgestimmtes Zusammenspiel aus strategischen Partnerschaften und Wertschöpfungsprozessen, die weit über die herkömmlichen Dienstleistungen eines Unternehmens hinausgeht.
Unser Standpunkt kompakt:
Die Etablierung eines Ökosystems erfordert die strategische Verankerung bei den Partnern sowie eine professionelle Zusammenarbeit. Mit geteilter Ressourcennutzung und kombinierter Wertschöpfung gelingt es, Mehrwert im Sinne von 1 + 1 = 3 zu schaffen. Der Plattformeigentümer, der Technologieanbieter und der Orchestrator übernehmen dafür entsprechende Verantwortung. Im Kern geht es um die Erfüllung des Nutzenversprechens und die Monetarisierung. Sie machen ein Ökosystem überlebensfähig. Wichtig sind auch die Datensicherheit und der Datenschutz, um das Vertrauen der Kunden zu halten. Der Aufbau und Betrieb eines Ökosystems erfordert unternehmerisches Geschick, Ausdauer und Anpassungsfähigkeit.
Ausgabe #08 • März 2023
Mit einem digitalen Zwilling wird ein Unternehmen in der digitalen Transformation (be)greifbar. Die Abhängigkeiten von Produkten zu Applikationen, Schnittstellen, Daten, Weisungen, Anleitungen, Formularen, Risiken, Kontrollen usw. sind gross. Mit einem digitalen Zwilling wird die Komplexität beherrschbar und in den Analyse- und Entwicklungsaufgaben wird das Unternehmen fassbar.
Unser Standpunkt kompakt:
Um die digitale Transformation zu steuern und die Komplexität zu beherrschen, macht die Verwendung eines «digitalen Zwillings» des Unternehmens Sinn. Dieses Abbild wird in einem Prozessmodell realisiert, dazu werden die Prozesse mit den Produkten, Applikationen, Schnittstellen, Daten, Weisungen, Anleitungen, Formularen, Risiken, Kontrollen usw. vernetzt. Dadurch sind die Abhängigkeiten erkennbar und die Komplexität von Veränderungen wird besser beherrschbar. Die Informationen im digitalen Zwilling werden (analog zu realen Welt) von den jeweiligen Fachstellen in einem föderalen Governance-Ansatz bewirtschaftet. So arbeiten verschiedene Managementbereiche mit dem identischen Modell des Unternehmens. Das Prozessmanagement ist die vernetzende Disziplin, denn Prozessmanagement hat keinen Selbstzweck.
Ausgabe #07 • Juli 2022
Für das Kundengeschäft werden ansprechende Lösungen gefordert (Websites, Mobile Apps usw.), die Kundinnen und Kunden auf mehreren Kanälen ansprechen und seine Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Auch gilt es, die Nase im Wind zu haben, um Angebote rasch zu lancieren oder auf Mitbewerber zu reagieren. Dies fordert eine gewisse Flexibilität. Die Kernsysteme eines Unternehmens für die Kundendaten, die Vertrags- und Auftragsverwaltung setzen im Gegensatz dazu auf Stabilität. Damit sind unterschiedliche Geschwindigkeiten vorhanden, die es in der Umsetzung von Digitalisierungs-Projekten zu berücksichtigen gilt.
Unser Standpunkt kompakt:
Für einen Geschäftsprozess mit einer Beratung und einem Vertragsabschluss werden typischerweise verschiedene Applikationen eingesetzt. Diese stellen die notwendigen Funktionen bereit. Diese Verzahnung von Anwendungen bietet die notwendige Spezialisierung, macht aber die Weiterentwicklungen schwerfällig. Durch die Entkoppelung von Kunden- und Kernsystemen über eine Digitalisierungsplattform gewinnen Unternehmen an Flexibilität. Die Digitalisierungsplattform integriert Applikationen über APIs und macht so die Komplexität beherrschbarer. Um dabei das Projektportfolio agil zu steuern und Vorhaben umsetzen, sollte eine Geschäftsarchitektur etabliert werden. Die Product Owner verantworten und planen die fachlichen Bausteine der Architektur und unterstützen die Umsetzung der Strategie. Die Process Owner bringen die Anforderungen an die End- To-End-Prozesse mit der Nutzung der Bausteine ein. Durch das «Lean Portfolio Management» wird der Elefant in Scheiben geschnitten und die Umsetzung in Etappen angegangen.
In der Ausgestaltung und Einführung dieser Konzepte unterstützt sie 360excellence, um Veränderungen umzusetzen, Ergebnisse gemeinsam zu erzielen und Menschen mit auf die Reise zu nehmen.
Ausgabe #06 • März 2022
Durchgängige Prozesse und Unternehmensstrukturen stehen sich manchmal im Weg. Ein «Prozess» ist darauf ausgelegt, eine Input-Leistung über mehrere Schritte in eine Output-Leistung zu transformieren und diesen Vorgang mittels Visualisierung (be)greifbar zu machen. Die Organisation des Unternehmens steht dabei nicht im Vordergrund. Wenn die Governance eines Unternehmens keine übergreifende Prozessverantwortung beinhaltet, ist die Frage «Wer ist für den Prozess verantwortlich?» kompliziert zu beantworten.
Unser Standpunkt kompakt:
«Ein End-to-End-Prozess ist ein Prozess, der aus sämtlichen zeitlich-logisch aufeinander folgenden Aktivitäten besteht, die zur Erfüllung eines Kundenbedürfnisses notwendig sind. Die Abwicklung des Prozesses erfolgt schrittweise und oft über mehrere Geschäftsbereiche oder auch externe Partner hinweg. Mit einer echten End-to-End-Sicht steht eine ganzheitliche Koordination oder Steuerung der Leistungserbringung oder deren Weiterentwicklung im Fokus. Die Verantwortung dazu nimmt ein Prozess-Team unter Leitung eines Process-Owners wahr. Das Prozessmanagement entwickelt sich damit zu einer vernetzten Management-Disziplin im Unternehmen.
Ausgabe #05 • Dezember 2021
Seit Unternehmen sich stärker am Stakeholder-Management als am Shareholder- Value orientieren, hat auch der Begriff der «Nachhaltigkeit» entsprechend Hochkonjunktur. Im Alltag wird der Begriff leider oft überstrapaziert. Die gezielte Analyse, Priorisierung und Umsetzung von Massnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit sind für Betriebe eine ansprechende Herausforderung.
Unser Standpunkt kompakt:
«KMU bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft und als wichtiger Teil der Gesellschaft sind sie gefordert, ihren Teil zu unserem nachhaltigen Wohlergehen beizutragen. Im Rahmen der Agenda 2030 ist die Politik gefordert, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO innert der nächsten paar Jahre zu erreichen. Die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln müssen angepasst werden, um diese Zielerreichung zu ermöglichen. Um den Handlungsbedarf zu erkennen und richtige Massnahmen zu priorisieren, müssen sich die Unternehmen vorbereiten. Ein Nachhaltigkeits- Assessment kombiniert mit einer Prozess- und Wertschöpfungs-Analyse sind dazu wesentliche Bausteine. Dieses Vorgehen gilt es in die Strategieentwicklung und ‑umsetzung zu integrieren. Denn heute bringt eine unternehmerische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit möglicherweise noch Wettbewerbsvorteile, morgen sind sie eine notwendige Voraussetzung.»
Ausgabe #04 • Juni 2021
Um eine strategische Veränderung in einem Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen, ist eine gehörige Portion an Inspiration und Engagement erforderlich. Diese beiden Aspekte bringen wir Menschen in die Veränderung ein. Das Engagement baut darauf auf, dass wir mit Überzeugung eine Reise antreten wollen – eine Reise hin zu einer Vision oder einem Zielbild. Und dieses Zielbild ermöglicht es, den anzustrebenden «Zustand» eines Unternehmens oder eines Leistungsangebots
zu visualisieren und zu diskutieren.
Unser Standpunkt kompakt:
«Bei umfassenden Veränderungen, die viele Anspruchsgruppen involvieren, sind gemeinsam entwickelte Zielvorstellungen unabdingbar. Ein Target Operating Model ermöglicht die Entwicklung, Diskussion und Verankerung eines solchen Zielbildes. Dabei kombiniert es die Kunden‑, Prozess‑, Organisations- und System Perspektive zu einer Gesamtsicht. Diese Gesamtsicht weist typischerweise eine hohe Komplexität auf, entspricht aber der Realität. Das TOM ermöglicht beispielsweise in einem Ökosystem, dass alle beteiligten Partner die Übersicht gewinnen und behalten. So erkennen die beteiligten Organisationen, welchen Beitrag sie für das Wertversprechen gegenüber den Kunden leisten.»
Ausgabe #03 • April 2021
Die Vorbereitung und Durchführung von integralen Applikationstests ist in heterogenen Systemlandschaften ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Berücksichtigung der Auflagen aus dem Datenschutzgesetz (DSG) gewinnt dabei als zusätzliche Herausforderung spürbar an Bedeutung.
Unser Standpunkt kompakt:
«Produktionsdaten stellen eine wertvolle Grundlage für Testdatenbestände dar. Eine zunehmende Sensibilisierung der Kunden und sich verschärfende datenschutzrechtliche Grundlagen in Bezug auf die Verwendung von produktiven Daten in nicht produktiven Systemen verunmöglichen diese Praxis in Zukunft. Die Lösung besteht darin, auf Basis von produktiven Datenbeständen über bewährte Methoden und Tools der Anonymisierung und Synthetisierung von sensiblen Datentypen einen rechtskonformen Testdatenbestand zu erzeugen und zu verwalten. Dieser Datenbestand trägt wesentlich zur Risikoreduktion von missbräuchlicher Datenverwendung bei, da keinerlei Rückschlüsse auf real existierende Personen oder besonders schützenswerte Daten ermöglich sind.»
Ausgabe #02 • Januar 2021
Als Menschen haben wir das Bedürfnis, unser Wirken bzw. unsere Arbeit sinnorientiert zu gestalten und auf Ziele auszurichten. Schliesslich ergibt sich aus der Zielerreichung eine entsprechende Zufriedenheit und oft auch etwas Stolz. Noch grundlegender als die Zielstrebigkeit ist die Frage nach dem Sinn – dem «Purpose», wie dieser aktuell bezeichnet wird. Die jüngere Generation stellt diese Frage bewusst, während (schon etwas) ältere Personen dazu etwas mehr Distanz haben. Denn «Sinnstiftung» ist, je nach Denkschule, die Aufgabe von Vorgesetzten und von Managern und nicht Sache der Mitarbeitenden. Das war gestern so, ist heute anders.
Unser Standpunkt kompakt:
«Für die Zusammenarbeit über mehrere Organisationen und Unternehmen oder mit unterschiedlichen Generationen sind auch zeitgemässe Führungsprozesse mit Zielvereinbarungen anzuwenden. Auch Seniorität und Autorität haben in der heutigen Führung ihren Platz, jedoch immer weniger aufgrund von Hierarchie, sondern auf der Basis von Respekt, Transparenz, Verständnis für das Ganze und Empathie. Mit der Sinnstiftung in Form eines Purpose und der Anwendung von aktuellen Zielvereinbarungs- und Messmethoden in Form von ‹OKR› entwickeln wir unsere Zusammenarbeit im Team weiter. Die Ziele orientieren sich dabei am Bedarf bzw. Potenzial unserer Kunden sowie unseres Unternehmens. So überprüfen wir, ob wir in den vorgenommenen Veränderungen vorankommen, entsprechende Ergebnisse erreichen und die Menschen Teil der Entwicklung sind.»
Ausgabe #01 • November 2020
Im Mai 2020 lancierte die SIX die Open-Banking-Lösung «b.Link» für den Finanzplatz Schweiz. Doch was bedeutet «Open Banking» überhaupt? Wie funktioniert b.Link? Wie können Unternehmen mit Open Banking neue Dienstleistungen anbieten oder von b.Link profitieren? Im folgenden Beitrag erläutern wir die wichtigsten Begriffe rund um Open Banking und beleuchten die Chancen und Herausforderungen.
Unser Standpunkt kompakt:
Die Zusammenarbeit in Ökosystemen erfordert von Banken die Fähigkeit, Open-Banking-Dienstleistungen für wesentliche Bankprozesse anzubieten. In der Schweiz kann Open Banking unternehmerisch gestaltet werden, es besteht keine regulatorische Pflicht. Produktive Lösungen sind im Markt bereits verfügbar, das Pilot-Stadium wurde verlassen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Modelle ist aber noch nicht gegeben.