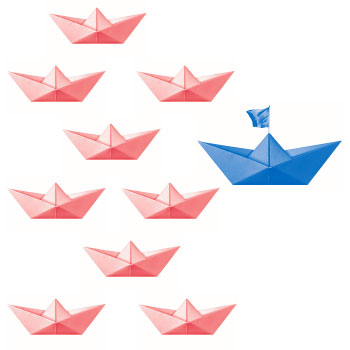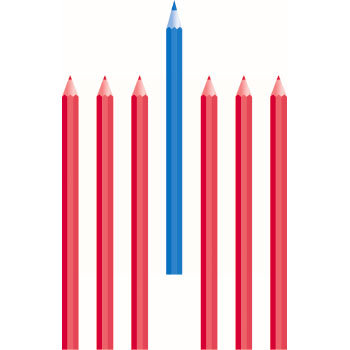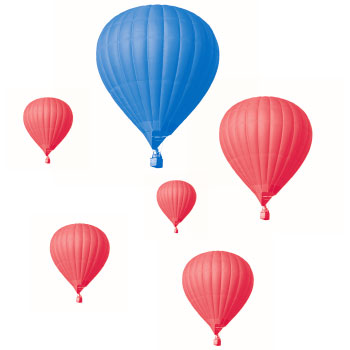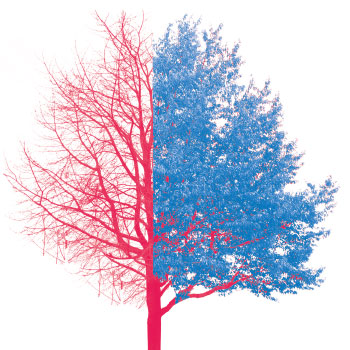Blockchain-Banking
Blockchain als Technologie etabliert
Die Verfahren zur verteilten oder dezentralen Speicherung von Daten wurde Mitte der 1990er-Jahre entwickelt. Eine erste Anwendung erfolgte erst 2008 mit Bitcoin. Die Blockchain und der Bitcoin sind aber keineswegs als Synonyme zu betrachten. Die Blockchain ist die Infrastruktur, welche Bitcoin ermöglicht. Neben Bitcoin gibt es mittlerweile zahlreiche andere Kryptowährungen wie «Ether» oder «Litecoin». Diese Währungen werden global in verteilten Kassenbüchern geführt. Die Kassenbücher nutzen die «Distributed Ledger Technologie» (DLT) welche als Blockchain eine gemeinschaftliche Buchführung mit allen Teilnehmenden ermöglicht.
Zur Marktreife der Blockchain tragen neben Kryptowährungen aber auch Projekte wie das «Cardossier» bei. Mit dem Cardossier wird der Lebenslauf eines Autos in der Blockchain abgebildet. Dies bietet für Käufer und Verkäufer aber auch für Versicherer, Garagen usw. enorme Transparenz. Die Plattform Cardossier ist seit Juni 2020 aktiv.
Nun aber zurück zum Bankgeschäft. Um das traditionsbewusste und vertrauenswürdige Bankgeschäft umfassender als «nur» mit Kryptowährungen in der Blockchain abzubilden, sind weiterführende Anwendungen notwendig. Bank Frick aus Liechtenstein bietet entsprechende Dienstleistungen und Lösungspakete an. Um eine praxisnahen Einblick in das Blockchain-Banking zu erhalten, haben wir mit Andreas Jenk (Business and Strategy Development Manager) ein Gespräch dazu geführt.

«Stand heute gibt es über 7’200 bekannte Kryptowährungen und ihre kombinierte Marktkapitalisierung liegt bei rund USD 350 Milliarden. Im Vergleich zum weltweit existierenden Fiatgeld, welches, je nach Definition, einen Gesamtwert von rund USD 95 Billionen aufweist, sind das aber immer noch lediglich 0,4%.»
Andreas Jenk, Bank Frick
Werte verwalten als «Tokens» in der Blockchain
Zu den Grundaufgaben einer Bank gehört die Verwaltung und Verwahrung von Werten für Kunden. Sei dies in Form von Bargeld, Wertpapieren in einem Depot oder physischen Objekten in einem Schrankfach. Mit der Blockchain ist diese Verwaltung von Werten nun digital möglich. Denn Objekte, die bisher nur schwer zu handeln waren, können in Tokens umgewandelt und aufgeteilt werden. So kann ein Gebäude, ein Schiff oder ein Unternehmensanteil mittels Tokens in Portionen handelbar gemacht werden. Auch Immaterialgüterrechte wie Patente, Lizenzen oder ein Stück Wald kann in Tokens umgewandelt und so einfacher und kostengünstiger gehandelt werden.
Ein Token stellt somit einen Anteil an einem Wert, Wertgegenstand oder ‑objekt dar. Das Token beinhaltet dabei auch die entsprechenden Rechte und Pflichten für den Besitzer. Die Tokens sind in der Blockchain abgebildet.
Die Tokens zu bilden wird als «Tokenisierung» bezeichnet. In diesem Prozess geht es darum, eine digitale Verbriefung vorzunehmen. Der ursprüngliche Wertgegenstand (z. B. ein Mehrfamilienhaus) wird in zahlreiche kleine Anteile aufgeteilt. Danach können verschiedene Personen Anteile an diesem Mehrfamilienhaus erwerben. Sie übernehmen dabei aber nicht nur die Rechte (z. B. Erträge aus Mietzinsen), sondern auch Pflichten im Sinne der Beteiligung an Unterhaltskosten. Durch die Tokenisierung kann am Beispiel einer Immobilie, diese in wesentlich kleinere Einheiten aufgeteilt werden als beispielsweise nur in einzelne Wohneinheiten. Dies ermöglicht einen breiteren Zugang zu Kapital und verteilt auch die Risiken entsprechend. Wesentlich ist, dass die Preisbildung für ein Token eine objektive, glaubwürdige Bewertung des ursprünglichen Wertgegenstandes als Basis benötigt. Der Vorgang der Preisbildung muss für die Käufer der Tokens transparent sein. Unverändert zum klassischen Bankgeschäft geht es auch hier um Vertrauen.
Sind die Tokens definiert und in der Blockchain abgebildet, so können diese schliesslich gehandelt werden. Da die Tokens typischerweise kleinere Einheiten darstellen, können wesentlich mehr Personen am Handel mit den digital verbrieften Werten teilhaben.
Stabile Währung im Ökosystem
Eine andere Dienstleistung im Blockchain-Banking ist der «Stable Coin». Diese stabile Münze kann als digitaler Geld-Ersatz gesehen werden. Der «Stable Coin» wird an eine Leitwährung (z. B. CHF, EUR oder USD) gekoppelt und bietet so eine mehrheitlich stabile Kursentwicklung. Dennoch kann diese digitale Währung schnell und zu sehr tiefen Gebühren gehandelt werden. So können Stable Coins in einem Ökosystem anstelle einer echten Währung genutzt werden. Der Wert der Stable Coins ist für alle Teilnehmer im Ökosystem nachvollziehbar.
«Ich werde oft gefragt, in welche Richtung sich der Bitcoin entwickeln wird. Und meine Antwort ist immer die gleiche: Ich habe keine Ahnung. Und jeder, der behauptet es zu wissen, hat genauso wenig Ahnung.» Andreas Jenk
Gesetzgebung für DLT auf gutem Weg
In der Schweiz wird aktuell die Gesetzgebung überarbeitet, so dass vorhandene Regulationen auch neue Technologien wie DLT oder Blockchain unterstützen. Das «DLT-Gesetz» ist somit als Rahmengesetz zu verstehen, das vorhandene Schweizer Gesetze erweitert. Unser Nachbar Liechtenstein ist der Schweiz diesbezüglich einen Schritt voraus. Das Gesetz über «Tokens und VT-Dienstleister» (TVTG) wurde am 3. Oktober 2019 verabschiedet und ist bereits in Kraft. Übrigens ist ein «VT-Dienstleister» ein Dienstleister der «vertrauenswürdige Technologien» für seine Dienstleistungen nutzt, die Blockchain ist eine solche Technologie.
Haben wir Ihr Interesse an Blockchain im Banking oder einer anderen Anwendung geweckt? Oder fragen Sie sich, wie Sie eine Wertanlage wie ihren Weinkeller mit Tokens digital handelbar machen können?
Machen Sie sich auf zu Veränderungen. Wir begleiten Sie. Stefan Lenz
«Die Blockchain ist als Technologie für den geschäftlichen Einsatz reif. Produktive Anwendungen sind in Betrieb, ohne dass wir dies als Konsument tatsächlich bemerken. Auch auf gesetzlicher Ebene wurde mit dem DLT-Gesetz eine vertrauenswürdige Grundlage geschaffen, das im Nationalrat mit 192:0 Stimmen angenommen wurde. Der Ständerat sollte dieser Ambition folgen. Mit dem DLT-Gesetz als Rahmen können ab 2021 neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle etabliert werden.»
Stefan Lenz